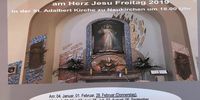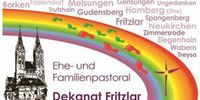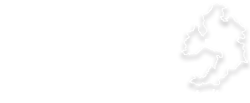PV Gottesdienste
Aschermittwoch
Aschermittwoch 2026 (18.02.2026)
St. Josef Kirche, Ziegenhain
18.00 Uhr - Heilige Messe mit Auflegung des Aschenkreuzes
Bild von Myriams-Fotos auf Pixabay
Aschermittwoch
Am
Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit; sie dauert bis Karsamstag, umfasst
also 46 Kalendertage - die 6 Sonntage sind vom Fasten ausgenommen, da Christen
an jedem Sonntag - also auch in der Fastenzeit - die Auferstehung Christi feiern; es
bleiben also genau 40 Fastentage.
Die Zahl 40
steht für einen umfassenden Zeitraum, der Wende und Neubeginn ermöglicht.
Schon im 2.
Jahrhundert bereitete man sich durch zweitägiges Fasten auf Ostersonntag vor.
Im 3. Jahrhundert wurde die Fastenzeit auf die Karwoche ausgedehnt. Im 4. Jahrhundert führte das
Konzil von Nicäa die 40-tägige Fastenzeit ein.
Alle Religionen
kennen Fastenzeiten. In der Alten Kirche wurden die Taufbewerber in der
Fastenzeit einen beschwerlichen Bußweg geführt, damit sie frei würden von allen
heidnischen Bindungen; dabei stand das Fasten als Verzicht auf bestimmte
Nahrung im Vordergrund. Dieser Bußweg hatte seinen Höhepunkt in der Feier der Osternacht , in der dann die Bewerber getauft
wurden.
Im
Mittelalter waren die Fastenbräuche streng: man durfte nur drei Bissen Brot und
drei Schluck Bier oder Wasser zu sich nehmen. 1486 erlaubte der Papst auch
Milchprodukte in der Fastenzeit . Ab Aschermittwoch sollen Christen
traditionell 40 Tage lang weder Alkohol noch Fleisch konsumieren. Eine erlaubte
Alternative ist Fisch, da er nicht blutet.
Fasten im
biblischen Sinn bedeutet aber eigentlich weniger die Einhaltung bestimmter
Vorschriften, als die Besinnung auf die Verantwortung, mit den Gaben Gottes und
seiner Schöpfung verantwortungsvoll umzugehen und diese maßvoll zu gebrauchen.
Fasten bezieht sich so gesehen nicht nur auf bestimmte Lebensbereiche wie das
Essen oder gilt nur eine bestimmte Zeitspanne. Bewusste Fastenzeiten können
aber Hilfe zu einem verantwortlicheren Leben sein. In diesem Sinne ist die
evangelische Aktion "Sieben Wochen ohne" seit inzwischen mehr als 10
Jahren sehr erfolgreich mit ihrem Aufruf zu einem selbstgewählten Verzicht in
der Passionszeit .
Der
Aschermittwoch erhielt seinen Namen, weil an ihm Asche der Palmen vom Palmsonntag des vergangenen Jahres geweiht und
den Gläubigen vom Priester auf Stirn oder Scheitel gestreut wird. Dabei
erinnert der Liturg an die Vergänglichkeit des Menschen: "Gedenke, o
Mensch, du bist Staub, und zum Staube kehrst du zurück." (vgl. Psalm 90,
3) Papst Urban II. führte diesen Brauch im 11. Jahrhundert ein, im 12.
Jahrhundert wurde festgelegt, dass die Bußasche von Palm- und Ölzweigen des
Vorjahres gewonnen werden muss.
Asche ist
Symbol der Vergänglichkeit, der Buße und Reue. Schon die Menschen im alten
Testament "hüllten sich in Sack und Asche", um ihrer Bußgesinnung
Ausdruck zu verleihen. Asche wurde früher als Putzmittel verwendet und ist so
auch Symbol für die Reinigung der Seele.